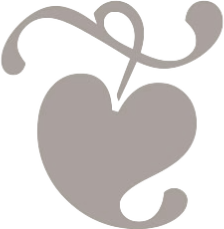


Am Waldrand, wo das Moos weich ist und das Licht nur zögerlich fällt, wuchs ein kleiner Fliegenpilz. Er war hübsch. Fast ein wenig zu hübsch. Seine rote Kappe glänzte, seine weißen Punkte waren ordentlich verteilt – so, als hätte jemand ihn dort sorgfältig platziert.
Aber niemand hatte ihn gepflanzt. Er war einfach da.
Der kleine Fliegenpilz war giftig. Das wusste er. Schon früh hatte er gemerkt, dass andere ihn mieden. Sie sagten es nicht direkt, aber sie blickten weg. Oder sprachen nur vom Wetter, wenn sie an ihm vorbeigingen.
Und so begann der Fliegenpilz, freundlich zu werden.
Er sagte schöne Dinge. Er war zuvorkommend, interessiert, klug. Er lernte, wie man andere Blüten schützt, wie man sich über sie beugt, wie man Fürsorge zeigt – ohne überhaupt gefragt worden zu sein.
Und dann kam sie. Ein kleines, unscheinbares Blümchen, mit zarten Blättern und einem offenen Blick.
Sie fragte nichts. Sie wollte nichts. Aber sie blieb.
Der Fliegenpilz spürte: Wenn sie bei ihm blieb, war er nicht mehr der Giftige. Dann war er der Beschützer. Der Verlässliche. Derjenige, der weiß, was gut für sie ist.
Und so sagte er: „Du bist zerbrechlich. Ich passe auf dich auf.“ Und: „Bleib hier, sonst verletzt du dich.“ Und: „Ohne mich bist du nicht sicher.“
Aber das Blümchen war nicht schwach. Es war nur leise. Und es hörte genau hin.
Es merkte, dass es sich verbog, wenn es unter seiner Kappe stand. Dass ihr Licht schräg wurde. Dass sie ihre eigenen Wurzeln nicht mehr spürte.
Der Fliegenpilz meinte es nicht böse. Er hatte einfach Angst, dass er ohne sie wieder nur ein Pilz wäre. Ein schöner. Aber allein. Als das Blümchen sich schließlich aufrichtete und in eine andere Richtung wuchs, sagte der Pilz leise: „Ich habe dich doch nur beschützt…“
Aber da hatte sie sich schon abgewandt. Und er blieb zurück – in seiner Schönheit, seiner Traurigkeit und seiner Weltansicht.
Noch immer giftig. Aber nicht mehr unbemerkt.
 zurück
zurück